C’est la vie! Es schert sich nicht um die Pläne des Menschen.
Und dann kommt doch alles völlig anders. So lautet mein Resümee nach den Ereignissen der letzten Tage. Am 1. November startete ich, wie geplant, meinen Intensiv-Schreibmonat. Nichts sollte mich abhalten, 50.000 Wörter zu schreiben. Genau zwei Tage lang konnte ich den Alltag „klein halten“, dann forderte das Leben meine Aufmerksamkeit. Man könnte auch sagen, es brach über mich herein. Traurige Mitteilungen aus der Familie machten es unmöglich, am Text zu arbeiten. Ich konnte mich kaum auf die Arbeit konzentrieren.
Da diese schlimme Nachricht offenbar nicht reichte, legte der Alltag noch kräftig nach in seinem Bemühen, mich vom Notebook fernzuhalten. Die Winterreifen lagern als letzte Hinterlassenschaft noch in der alten Heimat. Sie von der Provinz einmal quer durchs Land nach Berlin zu bringen, scheint unglaublich schwierig zu sein. Jedenfalls telefoniere ich seit Tagen täglich mit dem Autohaus, um zu erfahren, ob sie sich die komplexe Aufgabe wider Erwarten doch noch zutrauen. Momentan warten die Reifen auf ihre Verladung. Ich werde wohl weiter dranbleiben müssen.
Wie stets im November finden wir jetzt täglich Rechnungen im Briefkasten, die nicht einfach beglichen werden können. Die jährliche Abrechnung der Hausverwaltung beispielsweise und die Rechnung der Autoversicherung lesen sich in diesem Jahr ausgesprochen kryptisch. Was bedeutet, man prüft die Zahlenkolonnen, ruft beim Versender der Briefe an, um sich Details erklären zu lassen, verschwendet Zeit in Warteschleifen und mit begriffsstutzigen Servicemitarbeitern. Als habe das Wetter nur darauf gewartet, bis der NaNoWriMo beginnt, ändern sich die Temperaturen in Berlin, der sonnige Endlossommer mündet in einen feuchtkühlen Spätherbst. Für T-Shirts und Chucks ist die Zeit folglich endgültig vorbei, Pullover und Stiefel halten aber noch Sommerschlaf ganz hinten im Schrank. Das heißt, ich investiere weitere wertvolle Schreibzeit und sortiere den Kleiderschrank.
Ich weiß, das hört sich nach Klagen auf hohem Niveau, nach einem ganz normalen Alltag an. Ist es unmöglich, mir einen Monat oder auch nur ein paar Tage Zeit zu nehmen, um mich ausschließlich aufs Schreiben zu konzentrieren? Soll ich aufstecken und es im nächsten November wieder probieren? Soll ich meinen Biorhythmus überlisten und nur noch nachts schreiben, bei abgeschaltetem Telefon, um negative Nachrichten auf jeden Fall auf Abstand zu halten? Soll ich künftig die Jahresferien am Stück für einen Monat nehmen, abtauchen in eine Ferienwohnung weit weg von zu Hause?
Die letzte Frage werde ich mir im kommenden Jahr stellen. Jetzt stecke ich nicht auf, es wäre definitiv zu früh, auch wenn die 50.000 in der verbleibenden Zeit kaum zu schaffen sind. „Manchmal verlangt man zu viel von sich selbst“, erwiderte eine Bekannte, die Schriftstellerin Milena Moser, auf mein Lamento. Womit sie sicher recht hat. Aber warum muss alles ausgerechnet in diesem Monat, in diesen ersten Tagen passieren, wenn ich eben Anlauf genommen habe, mein Schreibsoll zu erreichen? Selbstzweifel machen sich breit, das Morgenmonster sitzt plötzlich auch tagsüber wie selbstverständlich auf meiner Schulter. Ihm allzu viel Raum zu geben, wäre falsch, weil es dann immer hartnäckiger daran arbeiten würde, mich zum Aufgeben zu bewegen.
Ich werde dem Rat von Dr. Doris Wolf folgen: Die Mannheimer Psychologin rät, die Brille zu wechseln. Keine rosarote, sondern eine Brille aufzusetzen, die den Blickwinkel verändert.
Welche Fragen stelle ich, sobald die neue Brille auf der Nase sitzt? Wer bestimmt, dass ich nur eine „gute“ Schreiberin bin, wenn ich 50.000 Wörter in 30 Tagen schaffe? Geht es nicht eigentlich darum, in einen permanenten Schreibfluss zu kommen, idealerweise einen Flow zu erleben, der mich auf der Glückswelle reiten lässt? Und geht es nicht schlicht darum, die Geschichte zu vollenden, letztlich das Buch endlich geschrieben zu haben?
Sicher ist: Das Leben nimmt keine Rücksicht auf Pläne und Abgabetermine. Das Morgenmonster sollte folglich aufhören mir vorzugaukeln, mein Schicksal wolle nicht, dass ich schreibe, weil ich sowieso untalentiert sei und mich lieber um die Familie, die Reifen und die Rechnungen kümmern sollte. Ich schaue durch die blank geputzten neuen Brillengläser, drehe den Kopf und stelle fest: Die bislang erreichte Wörterzahl ist eher bescheiden. Aber ich habe ungeachtet aller Sorgen und Probleme der letzten Tage in meinen kurzen Phasen der Konzentration tiefer in die Geschichte hineingefunden als je zuvor.
Liebes Monster, kann sein, es fehlt mir an Talent. An Durchhaltevermögen mangelt es mir jedoch keinesfalls!
Last modified: 11. November 2018


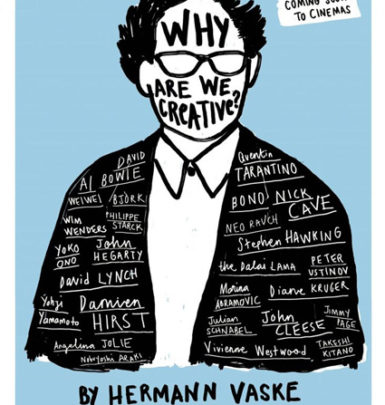


 Bloggeramt.de
Bloggeramt.de